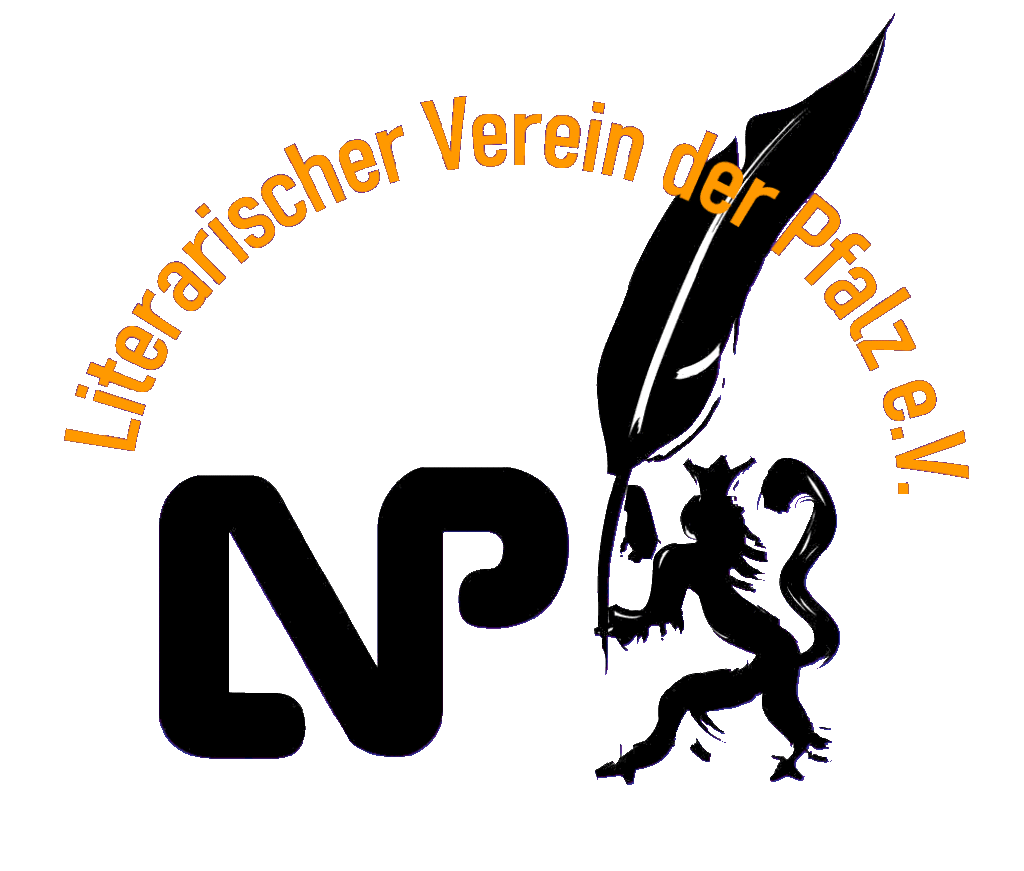Ulrich Bunjes, so alt wie die Bundesrepublik, hat während seines Arbeitslebens pausenlos geschrieben – politische Texte, Projektskizzen, Evaluationsberichte, Artikel über europäische Themen, und Reden (vor allem für andere). Erst danach begann er, Prosa zu verfassen. Seine Kurzgeschichten drehen sich in der Regel um die Tücken des Alltags, die Abgründe menschlicher Beziehungen und die Eigenheiten der Kommunikation.
Seine ersten literarischen Schritte machte er in der Schreibwerkstatt der iranisch-britischen Autorin Bahiyyih Nakhjavani (Strasbourg). Nach der Übersiedlung nach Speyer wurde er Mitglied im Literarischen Verein der Pfalz und arbeitet seither in der Autorengruppe „Spira” mit (die er seit 2022 leitet) sowie im „Club der lebenden Autoren” (Speyer).
Veröffentlichungen
Die letzten Veröffentlichungen:
- Trunk, Branch, Leaf. Short stories. 2019
- Lockdown Heroes. Short stories. 2020
- Müllerstraße, Wedding und andere Texte 2017–2021. 2. Aufl. 2022
- Ein Held in der Buttermilch. Stories und Gedichte. Norderstedt: BoD 2022
(ISBN 978 3 756 88648 7, E‑Book 978 3 756 86798 1) - Ein Kessel Pommes. Geschichten. Norderstedt: BoD 2023 (ISBN 978 3 758 31592 3, E‑Book 978 3 758 39025 8)
Leseprobe
Harry lehnt sich gegen den Tisch, zündet sich mit der fast zu Ende gerauchten eine neue Camel an und betrachtet die Menschenmenge um sich herum. Sein müder Blick schweift zum Ende der Straße, wo über die Köpfe der zahllosen durstigen Besucher der Weinmesse hinweg der gedrungene Bau des Doms gerade noch sichtbar ist. Wein am Dom – sein Deutsch reicht aus, den Sinn zu verstehen. Das norwegische Wort vin ist ja nicht so verschieden.
Ein tiefer Zug aus der Zigarette. Jetzt kann er entspannen. Der Fall, der ihn nach Deutschland brachte, ist gelöst. Harry ist mit sich und seiner Arbeit zufrieden. Das Dezernat für Gewaltverbrechen der Osloer Polizei wird die Kosten seiner Reise an den Rhein ohne Klagen begleichen. Obwohl Gunnar Hagen als sein Vorgesetzter ja in diesem Fall massive Vorbehalte gegen Harrys Fahndungsmethoden erhoben hatte. Schnee von gestern. Über Vorbehalte hat er sich immer hinweggesetzt.
Die Weinflaschen auf den Tischen um ihn herum lachen ihn an. Jetzt in dieser Hitze nur nicht schwach werden, sonst kommt er morgen früh nicht rechtzeitig zum Flughafen. Bloß nicht abstürzen, redet er sich selbst zu. Die Beziehung zu Rakel ist gerade wieder einigermaßen im Lot, da kann er sich keine Schwäche erlauben.
„Kann ich Ihnen etwas anbieten?“ fragt der Winzer hinter dem kleinen Tresen und reißt ihn aus seinen Gedanken. Harry schüttelt den Kopf und versucht, dem Frager klarzumachen, dass er keinen Alkohol will. Keinen darf. Der Mann scheint nicht zu verstehen, vielleicht weil es heute hier praktisch nur ums Trinken geht, und stellt die Frage noch einmal. Harry will Bedauern ausdrücken, aber offenbar gelingt es nur unzureichend. „Ah“, sagt der Mann und strahlt, „ich mache Ihnen eine Schorle.“ Harry hat das Wort noch nie gehört, aber er freut sich, dass er sich anscheinend verständlich gemacht hat. Der Mann reicht ihm ein volles Halbliterglas und sagt: „alla hopp“. Harry missversteht und sagt etwas förmlich: „Hole. Harry Hole. My name is Harry.”
Die Hitze ist einfach zu groß und Harry nimmt einen großen Schluck der unbekannten Flüssigkeit. Tut gut, denkt er, ist nicht Wein. Er leert das Glas in zwei großen Zügen und hält es zum Nachschenken über den Tisch. Der Mann hinter dem Tresen lächelt.
Die Wirkung lässt nicht auf sich warten. Harry merkt es nicht sofort, aber bald setzt das Gefühl der Leichtigkeit ein, das er so gut kennt und das er sich eigentlich verboten hat. Seine Gedanken bekommen Flügel. Er denkt an Oleg und an Valentin Gjertsen. Verdammt, der Drink kommt zu stark. Harry muss sich am Tisch festhalten. Dann denkt er an morgen, an Øystein und an das Schrøder. Und an seinen Vater Jo, den Schriftsteller, Musiker, Fußballer und Journalisten.
Harry verspürt eine tiefe Müdigkeit und vergisst, wo er ist. Plötzlich hört er neben sich eine undeutliche Stimme: „Haben Euer Ehren eine Minute?“
Harry kneift mehrmals seine Augen zu, um klarer zu sehen, was ihm trotz seiner jahrelangen Erfahrung im Umgang mit Unbekanntem, Neuem nur zum Teil gelingt. Der Sprecher trägt offenbar eine Rheingrafenhose, die unter den Knien mit Spitzenmanschetten zusammengehalten wird, dazu Seidenstrümpfe und Stiefel mit weiten Stulpen. Die gepuderte Zopfperücke und der bunte Justeaucorps mit den großen Taschen und den mit Knopflöchern besetzten Überklappen passen definitiv nicht zu diesem Weinfest, denkt Harry. Ihm wird schwindlig, als ihm zu seiner grenzenlosen Verwunderung bewusstwird, dass er aus irgendeiner Ecke seines Gedächtnisses das Wort Justeaucorps holen kann.
Die Erscheinung neben ihm hält in der rechten Hand den Dreispitz, die andere ruht auf einem Degen. „Bin auf der Durchreise nach Heidelberg, Quartier machen für Ihre Majestät, die Herzogin von Orléans. Elisabeth Charlotte. Madame“, sagt der Mann und deutet eine Verbeugung an: „Vous permettez? Etienne de Polier de Bottens.“
Harry kommt aus dem Staunen nicht heraus; auf einmal hat er trotz der bleiernen Müdigkeit keinerlei Probleme, das verzopfte deutsch-französische Mischmasch zu verstehen.
Der komische Vogel neben ihm nippt immer wieder an einem Glas und erzählt dann, dass „Ihre Majestät die Herzogin“ nach dem Tod ihres Mannes gern noch einmal an den Ort ihrer Kindheit zurückkehren würde. „Auch wenn die Reise genierlich ist und das alte Schloss immer noch zerstöret.“ Dann berichtet Etienne, dem der Wein zunehmend die Zunge lockert, dass man bei Hofe und in Saint-Cloud „mit löblichem Interesse“ die Herausbildung der gegen Spanien gerichteten Allianz verfolgt. Was allerdings nicht überall „goutieret“ werde.
„Erzähl mal“, sagt Harry langsam zu Etienne. „Interessiert mich auch als Ermittler.“ Dabei hat er keine Ahnung, worum es geht.
Etienne strahlt über das ganze Gesicht und wippt angeregt mit seinem Dreispitz. Dann berichtet er von dem Hin und Her der Koalitionen, dem Vertrag von Utrecht, der wichtigen Rolle des Regenten für den fünfzehnten Ludwig und dem Minister Dubois. Harry muss sich schwer zusammenreißen, um nicht den Faden zu verlieren; sein eigenes Königshaus ist dagegen ja eher simpel gestrickt.
Also erzählt Etienne einfach weiter, von der Madame du Maine, die sich von Voltaire Pamphlete gegen den Regenten schreiben lässt. Vom spanischen Botschafter, der sich für Madames Geschmack sehr in die Belange des Hofes einmischt. Vom Herzog von Richelieu. Und von John Law und dem Schuldenberg, den der alte König bei seinem Tode hinterlassen hat.
Harry schwirrt der Kopf von all den Namen, aber er stutzt, als er den Namen des spanischen Botschafters hört: Cellamare. Kommt mir bekannt vor, denkt er und hat dabei Mühe, die Augen offen zu halten. Hat irgendwie einen schlechten Klang, als sei er in einem seiner früheren Fälle schon einmal aufgetaucht. Cellamare. Kann nicht sein. Ist es aber doch. Wo war das? Wann war das?
Als er zu Etienne blickt, sieht er, dass dessen Konturen ein wenig verschwimmen. Die dritte Schorle war nicht gut, denkt er, hätte ich nicht machen sollen. Er reißt sich noch einmal zusammen und sagt mit schwerer Zunge: „Wenn du mich fragst, würde ich die Reise nach Heidelberg abblasen. Die Sache ist zu heikel. Auch wenn deine Chefin sauer wird, das musst du in Kauf nehmen. Sie wird in Paris gebraucht, da braut sich etwas zusammen. Frauen sind wichtig, ohne sie wären wir verloren. Ich würde dir raten, den Botschafter überwachen zu lassen. Vielleicht seine Depeschen abfangen. In seiner Kutsche nachschauen. Botschafter sind immer verdächtig.“ Harry kommt sich albern vor, als er sich die Worte „Depeschen“ und „Kutsche“ sagen hört, aber er nimmt es hin. Eine tiefe Entspannung hat sich seiner bemächtigt.
Etienne, den er jetzt nur noch schwach im Gegenlicht ausmachen kann, setzt seinen Dreispitz auf und wendet sich zum Gehen. „Erlaubet mir, Euch im Namen der Herzogin untertänigst zu danken. Ich werde sogleich zurückeilen und Euer Exzellenz‘ Considerationen gebührlich weitergeben. Adieu!“ Dann verschwindet er mit einer Verbeugung aus Harrys Gesichtsfeld. Die Abenddämmerung hat eingesetzt und verschluckt schnell den merkwürdigen Adligen.
Harrys Beine drohen nachzugeben und er muss sich setzen. Mit dem Rücken lehnt er an eine große schwarze Statue, die ihn an einen großen Pilger erinnert. Er ist zu müde, um sich eine neue Zigarette anzuzünden. Bevor er einschläft, denkt er noch an die drei Gläser des merkwürdigen Gebräus, das er maßlos unterschätzt hat und von dem er Beate Lønn morgen in Oslo erzählen muss. Dann wird alles schwarz.
Als er nach Stunden in der kalten Nachtluft erwacht, sind die Stände mit den Weinflaschen um ihn herum schon abgebaut. Ihm tun die Beine und der Rücken weh und er hat Mühe, sich an die Adresse seines Hotels zu erinnern. Noch größere Schwierigkeiten bereitet es ihm allerdings, die Eindrücke des Abends zu sortieren und in einen logischen Zusammenhang zu bringen. War da was? Was war da?
Als sein Handy am nächsten Morgen wieder aufgeladen ist, googelt er nach dem Namen, der ihm nicht aus dem Sinn geht: Cellamare. Er findet eine verrückte Geschichte von Politik, Aufruhr, Verrat und Vergeltung. Muss ich dem alten Jo Nesbø erzählen, denkt er; Vater macht daraus einen neuen Thriller, der wie all seine anderen um die Welt gehen wird. Mit der guten Liselotte, der größten aller Briefschreiberinnen, als Hauptperson. Nach Heidelberg ist sie ja offenbar nie mehr zurückgekehrt. Merkwürdig eigentlich.
Wenige Stunden später erreicht Harry pünktlich seine Heimatstadt im Norden.
Ulrich Bunjes: „Harry” (2021). Der Text entstand für eine Veranstaltung im Rahmen des KulturSommers Rheinland-Pfalz 2021